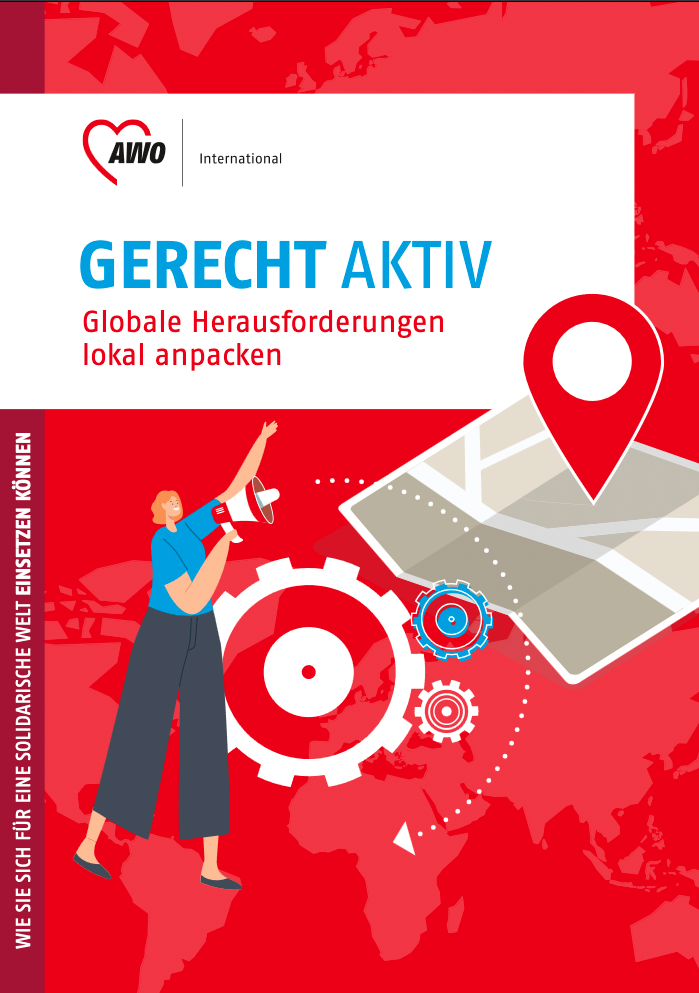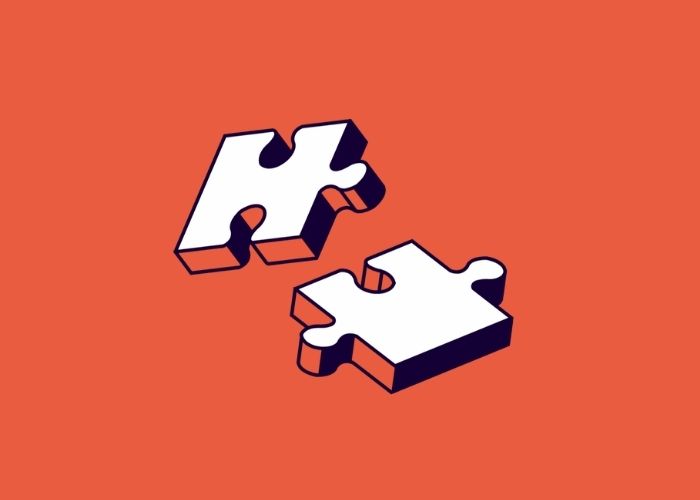Wie wollen wir leben? Wem dient die Wirtschaft? Welche Rolle spielt Bildung im Rahmen einer sozial-ökologischen Transformation? Was bedeutet globale Gerechtigkeit?
Bei dem Versuch, diese Fragen zu beantworten, greifen Menschen auf das Wissen zurück, das sie durch Aufwachsen, Erfahrungen und Bildung erworben haben. Vorstellungen davon, was (un-)möglich ist, sind abhängig davon, was wir als normal begreifen. Doch auch Normalität ist relativ und abhängig vom Kontext. Normalität ist eng verstrickt mit kulturellen, politischen und historischen Prozessen – also auch mit konkreten Machtverhältnissen.
Will Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung einen relevanten Beitrag zu einer gerechteren und wirklich nachhaltigen Lebens- und Produktionsweise leisten, dann ist sie meines Erachtens gut beraten, ausbeuterische Lebens- und Produktionsweisen sowie deren Ursachen kritisch in den Blick zu nehmen. Das bedeutet auch, dass Globales Lernen die eigenen Wissensgrundlagen und Perspektiven hinterfragt und stetig anpasst – denn diese sind nicht frei von den genannten kulturellen, politischen und historischen Prozessen. In diesem Sinne gibt es keine neutrale Bildung – lediglich einen mehr oder weniger transparenten und reflektierten Umgang mit der eigenen Position.
Transformative Bildung als kritisch-emanzipatorisches Globales Lernen hinterfragt sowohl seine Inhalte als auch die Art der Vermittlung und die Begleitung von Lernprozessen. Auf wessen Erfahrungen, Perspektiven und Wissensgrundlagen wird Globales Lernen durchgeführt und entwickelt? Wer spricht und wer nicht? Wessen Interessen sind vertreten, wessen nicht? Welche diskriminierenden Stereotype habe ich als Multiplikator*in in dieser Gesellschaft erlernt und wie kann ich sie verlernen? Wie hängen verschiedene Krisen und Ausbeutungsformen mit Lebensweisen im Globalen Norden zusammen – etwa Klimakrise, koloniale Kontinuitäten, Rassismus, Geschlechterungerechtigkeiten und eigenes (Konsum-)Verhalten? Eine solche transformative Bildung ist deshalb transformativ, weil sie Menschen stärkt und ermutigt, sich ihre eigene Meinung zu bilden und sich zu positionieren. Sie geht über kognitive Wissensvermittlung hinaus und adressiert auch die emotionale Seite großer verunsichernder Veränderungen. Ein Globales Lernen in diesem Sinne orientiert sich dabei mehr an kritisch-emanzipatorischer Bildung und den dort existierenden Didaktik- und Wissensressourcen. Beide Bereiche, Globales Lernen/BNE und kritische politische Bildung, sind noch zu wenig aufeinander bezogen. Berücksichtigen wir im Globalen Lernen Fragen von Macht und Repräsentation, so laufen wir weniger Gefahr, jene Glaubens- und Wissenssysteme zu reproduzieren, die nicht nachhaltige und ausbeuterische Lebens- und Produktionsweisen stützen. Das kann auch bedeuten, Diskurse zu öffnen, neue Zielgruppen zu erreichen, Allianzen mit diversen gesellschaftlichen Akteur*innen aufzubauen etc. Demgegenüber wird noch allzu oft lediglich Wissen über vermeintliche Nachhaltigkeit vermittelt – oft im Sinne individueller Verhaltensveränderungen basierend auf technologischem Fortschritt allein. Jedoch stärken die maßgeblichen Rahmendokumente, etwa die aktuelle Roadmap der UNESCO zur BNE, kritisch-emanzipatorische Elemente. Damit eine transformative Bildung auch wirklich möglich wird, ist es wichtig, dass Globales Lernen nicht bei Kritik verharrt, sondern Ansätze und Beispiele aus der ganzen Welt zur Diskussion stellt und erfahrbar macht, die schon heute solidarische Formen des Lebens und Wirtschaftens ausprobieren und erdenken. Erst so wird globale Gerechtigkeit innerhalb der planetaren Grenzen denkbarer und demokratisch verhandelbar. Dies alles erfordert psycho-emotionale und soziale Kompetenzen wie Resilienzfähigkeit, Konfliktfähigkeit oder Empathiefähigkeit, deren Aktivierung und Einübung ebenfalls Teil von Globalem Lernen sein können. Denn letztlich dreht sich sozial-ökologische Transformation um die Frage, welche Formen von materiellen und sozialen Beziehungen wir mit anderen Menschen sowie der Natur haben wollen und wie wir diese ausgestalten – es geht um die Frage, wie wir solidarische und nachhaltige Lebensweisen strukturell und kulturell etablieren, die vielfältige globale wie auch lokale Gegebenheiten berücksichtigen.
Erschienen in: GERECHT AKTIV Globale Herausforderungen lokal anpacken, Herausgegeben von AWO International