Allzu oft bewegen wir uns in der Frage, wer für die Abwendung der Klimakrise die Verantwortung tragen muss, in der Abwägung zwischen Individuum und Politik. Ist es nun wichtig weniger zu konsumieren, zu fliegen, Fleisch zu essen? Oder bringt das sowieso alles nichts, solange die Politik keine Gesetze macht oder sie nicht umsetzt? Solange Unternehmen uns ausbeuten, sodass wir uns fair, bio und slow gar nicht leisten können? In dieser Abwägung, vergessen wir oft eine andere Schieflage – die zwischen Globalem Norden und Süden [1]. Denn während wir noch über Abwendung sprechen und gerade die ersten Auswirkungen spüren, ist der Klimakollaps auf anderen Teilen der Erde schon lange eine harte Realität.
Bereits 2007 wurde bei der COP17 erstmals ausdrücklich der Begriff „Verlust und Schaden“ im Zusammenhang mit der Forderung nach verstärkten Anpassungsmaßnahmen eingeführt. Erst letztes Jahr – 16 Jahre später – wurde der Fonds endlich ins Leben gerufen. Allerdings sind die Beiträge freiwillig und erst ein Bruchteil der benötigten Summe wurde zugesagt.
Die reichen und industrialisierten Länder des globalen Nordens sind historisch hauptverantwortlich für die Klimakrise und treiben sie auch heute noch mit ihrem überwältigend hohen Energie- und Ressourcenverbrauch voran. Deutschland steht auf der Liste der historischen Emissionen auf Platz 4, obwohl hier nur etwa 1 % der Weltbevölkerung lebt. Der Ressourcenverbrauch im Globalen Norden ist nicht nur vier mal so hoch wie die sichere Pro-Kopf-Grenze für den Planeten, die Ressourcen stammen auch noch zum großen Teil aus dem Globalen Süden. Die historische Verantwortung endet aber nicht beim Energie- oder Ressourcenverbrauch. Industriestaaten im Globalen Norden im Allgemeinen, aber auch Deutschland im Speziellen konnten nur diese enormen CO2 Emmissionen anhäufen durch die Kolonialisierung des Globalen Südens. Die strukturelle Destabilisierung, die durch die massive Gewalt und Einflussnahme entstanden ist, hat heute noch Auswirkungen und äußert sich unter anderem durch Fluten, Stürme und Dürren in den betroffenen Gebieten. Denn die Klimakrise trifft den Globalen Süden nicht zufällig härter, es ist eine Frage der Anpassungsfähigkeit dieser Länder. Diese Vulnerabilität ist darauf zurückzuführen, dass sie am wenigsten von den wirtschaftlichen Prozessen profitiert haben, die die Klimakrise antreiben, und daher weniger Kapazitäten und Ressourcen haben, um sich anzupassen und zu reagieren, was wiederum zu einer Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten führt.
Das globale Handelssystem mit ungleichen Handelsbedingungen, das auf neokolonialen Machtungleichheiten beruht, ermöglicht es dem Globalen Norden, dem Globalen Süden jährlich den Wert von über 10 Billionen Dollar zu entziehen. Das ist eine 1 mit 13 Nullen und das 30-fache der Summe, die die Länder des Globalen Südens als »Entwicklungshilfe« erhalten. Damit könnte man extreme Armut weltweit 70-mal beenden. Auch das vom Globalen Norden geprägte Finanzsystem benachteiligt Länder des Globalen Südens extrem, so ist es schwieriger und teurer für jene Kredite aufzunehmen. Dies führt zu ungleichen Kapazitäten zur Bewältigung von Auswirkungen der Klimakrise.
Statt sich gegen neue Umweltbedingungen zu wappnen, soziale und wirtschaftliche Infrastrukturen aufzubauen sind ehemals kolonisierte Länder damit beschäftigt, Schulden oder gar nur die Zinsen der Schulden abzubezahlen.
Ein anschauliches Beispiel für die Absurdität dieser Schuldenverteilungist Haiti. Nach der Revolution 1804 und der damit erklärten Unabhängigkeit von Frankreich, wurde Haiti gezwungen, die französischen Kolonialherren für ihre “Verluste” zu kompensieren. 1825 hat Haiti dieser Forderung zugestimmt, erst 1947 konnten die Schulden fertig abgezahlt werden.
Insgesamt hat der Globale Norden seit den 1980er-Jahren allein über 4 Billionen Dollar an Zinszahlungen vom Globalen Süden eingenommen.
Ein sehr anschauliches und eindrückliches Gegenbeispiel für den Umgang mit transnationalen Schulden, ist der Schuldenerlass für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, der das »Wirtschaftswunder« des Landes ermöglichte. Wenn also dem Land, das für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich war, damals die Schulden gestrichen werden konnten, dann können sie sicherlich auch erlassen werden, um einen gerechten Übergang im Globalen Süden zu ermöglichen!
Darüber hinaus führt die Verschuldung des Südens gegenüber dem Norden zu mehr Ungleichheit, Extraktivismus, Ausbeutung natürlicher Ressourcen, ungleichem Austausch und wirtschaftlicher Abhängigkeit und hindert die verschuldeten Länder daran, ihren eigenen Entwicklungsweg zu bestimmen. »Ökologische Schuld« kann ein Mittel sein, um das vergangene und gegenwärtige Verhalten der Länder des Globalen Nordens, aber auch der transnationalen Konzerne anzuprangern. Ziel dieser Anklage ist es unter anderem, die beschuldigten Länder dazu zu bringen, ihre Fehler anzuerkennen, Wiedergutmachung oder Entschädigung zu zahlen, zukünftig anders zu handeln und die Länder des Globalen Südens gleichberechtigt zu behandeln. Klimareparationen müssen mehr als materielle Finanzreparationen sein, sondern sind ein langwieriger Prozess transnationaler Gerechtigkeit.
Eine Definition für Klimareparationen wurde von Maxine Burkett vorgeschlagen, der zufolge drei entscheidende Elemente dazugehören. Erstens braucht es eine Entschuldigung und Anerkennung der Klimaschuld, aber auch eine Wiedergutmachung und die Rückerstattung der zahlreichen finanziellen, sozialen und ökologischen Schulden der Länder des Globalen Nordens an die des Globalen Südens, die während der kolonialen Vergangenheit und durch die neokoloniale Dynamik von heute entstanden sind. Zweitens braucht es eine finanzielle oder sonstige Entschädigung, die dieser Entschuldigung tatsächliches oder symbolisches Gewicht verleiht. Klimareparationen sind Strategien und Maßnahmen, die ein Staat ergreift, um vergangene und gegenwärtige systematische Ungerechtigkeiten im Zusammenhang mit der Klimakrise wiedergutzumachen und die (Welt-)Wirtschaft so umzubauen, dass Klimagerechtigkeit, Wohlergehen und Gleichheit für alle Menschen weltweit gewährleistet sind. Drittens braucht es eine Verpflichtung des Täters, die strafbare Handlung nicht zu wiederholen, auch bekannt als die »Garantie der Nichtwiederholung«. Klimagerechtigkeit muss die Fragen von Gleichheit und Gerechtigkeit bei der Bewältigung des Klimawandels einbeziehen und kann nicht als etwas angesehen werden, das außerhalb eines Systems stattfindet, welches gleichzeitig Diskriminierung aufrechterhält. Einer ernsthaften Auseinandersetzung müsste also eine Änderung des Systems folgen, sodass kein weiterer Schaden verursacht wird. Konkret bedeutet das eine Wirtschaft jenseits von Wachstum und Extraktivismus und eine Gesellschaft nicht auf einer impererialen Lebensweise beruht.
Die Klimakrise ist eine Frage der globalen Gerechtigkeit und erfordert kollektives Handeln, indem wir nicht nur in die Zukunft blicken, um die Auswirkungen abzumildern, sondern auch in die Vergangenheit, um die Ursachen anzugehen und das historische Unrecht zu beheben.
[1]
Die Einteilung der Weltgemeinschaft in zwei Ländergruppen, die sich jeweils oben oder unten auf der Landkarte befinden, wird der Komplexität der globalen Beziehungen, vor allem historisch natürlich nicht gerecht. Die Begriffe sind also als grobe Zusammenfassung der strukturellen Machtverhältnisse zu verstehen.
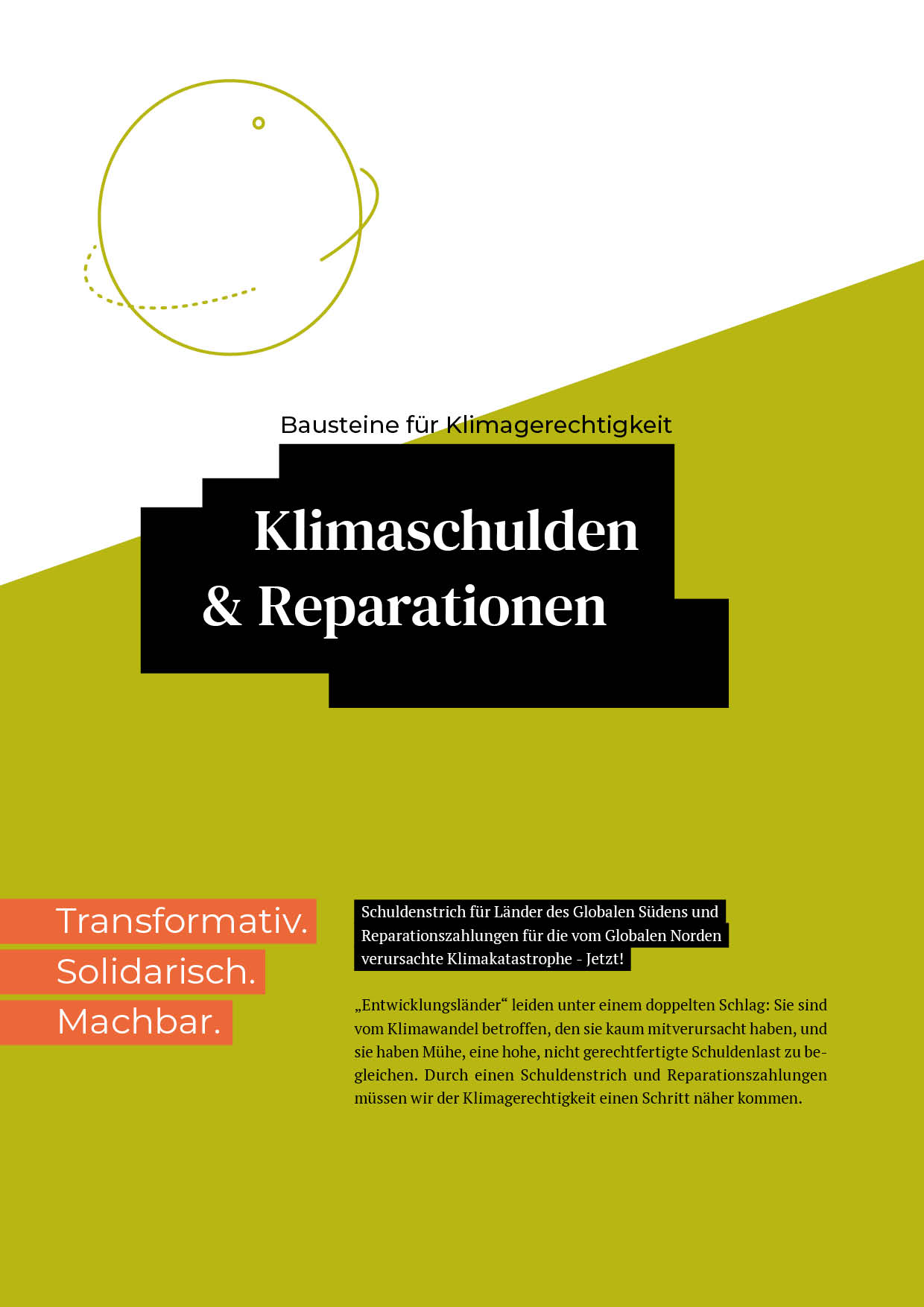
Klimaschulden und Reparationen
Bausteine für Klimagerechtigkeit
Schuldenstrich für Länder des Globalen Südens und Reparationszahlungen für die vom Globalen Norden verursachte Klimakatastrophe – Jetzt!
Der Beitrag ist entstanden für unsere Rubrik „Zukunft für alle“ im wirtschaftsphilosophischen Magazin Agora42. Dieser Text war Teil der Ausgabe 1/2025 „Verantwortung“.
Bildquelle: Oliver Kornblihtt/Mídia NINJA (CC BY-NC 2.0)



