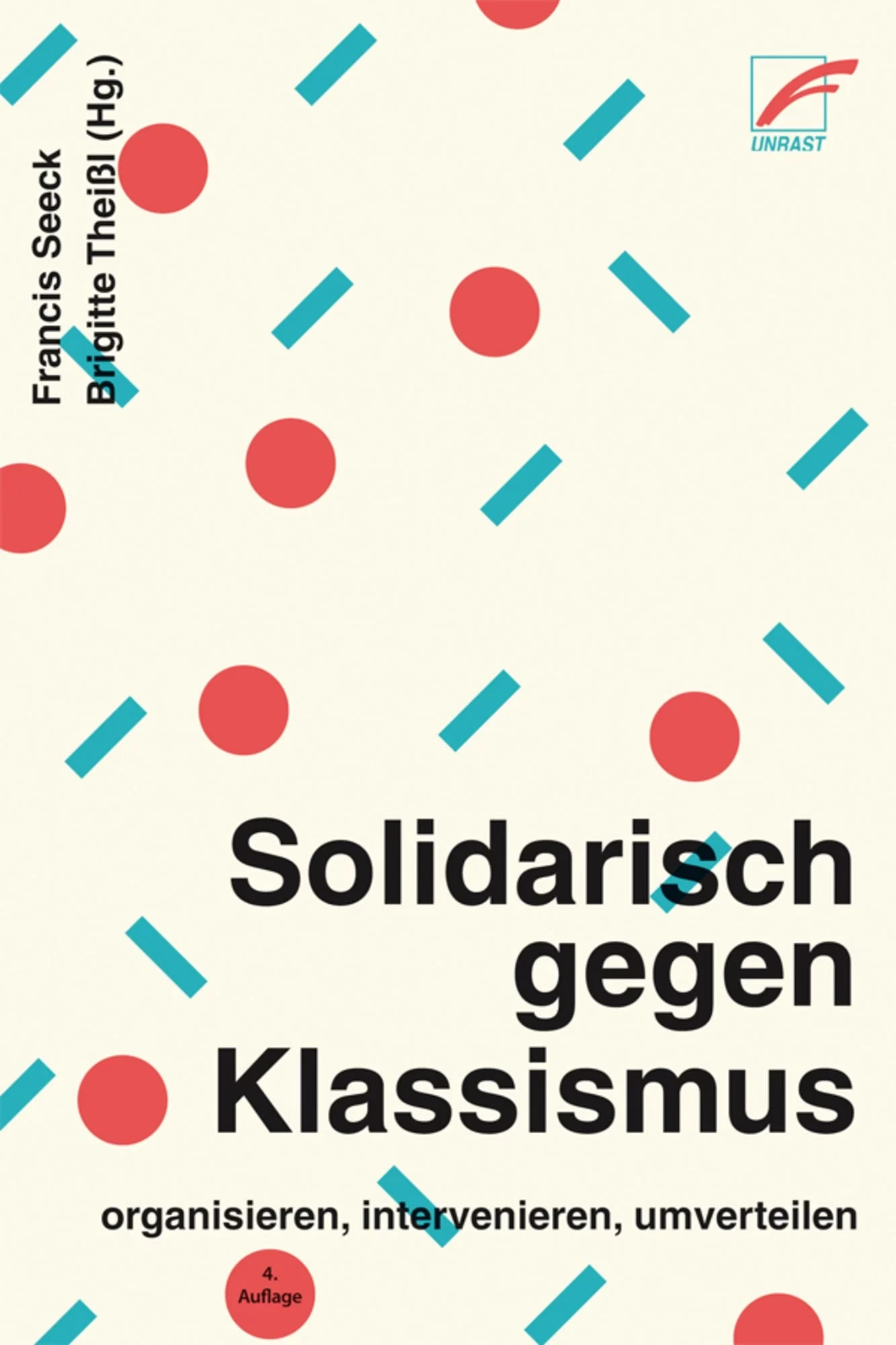Erfahrungen im Umgang mit Klassismus in einem Kollektiv politischer Bildungs- und Projektarbeit.
Unser Beitrag im Buch „Solidarisch gegen Klassismus – organisieren, intervenieren, umverteilen“, herausgegeben von Francis Seeck, Brigitte Theißl, ab Seite 117.
Die Grundidee eines Kollektivs ist, dass darin alle gleich viel mitbestimmen können, alle die gleichen Rechte haben – alle gleich viel zählen. Was aber, wenn nie alle die gleichen Voraussetzungen haben, um beim selbstorganisierten, basisdemokratischen Zusammenarbeiten gut zurechtzukommen und die eigene Rolle zu finden? Wenn ein Kollektiv seinen Anspruch ernst nimmt, dann bedeutet das, Unterschiede wahrzunehmen und anzuerkennen, dass Menschen verschieden privilegiert sind und diskriminiert werden – Klassismus ist dabei eine von vielen Diskriminierungsformen. Dann geht es darum, einen solidarischen Umgang damit einzuüben. Klingt einleuchtend, ist in der Praxis herausfordernd, aber es führt kein Weg daran vorbei.
In dem Artikel erzählen Charlotte und Nadine davon, wie wir im Konzeptwerk versuchen, zusammen solidarisch und sensibel mit Klassismus umzugehen.
Darin geht es einerseits darum, wie herausfordernd es für Menschen war – oder ist –, das Thema Klassismus anzusprechen, die aus Arbeiterinnenhaushalten kommen und/oder im Kontext von Klassismus diskriminiert werden. Ein scheinbar lockeres Gespräch über Politik beim Mittagessen ist für manche selbstverständlich – für andere Stress, für manche etwas, das sie von klein auf gewohnt sind – für andere verunsichernd und nie Teil ihrer Welt gewesen. Obwohl auch die Arbeiterinnenkinder im Konzeptwerk alle studiert haben, gibt es trotzdem diesen Unterschied. Und er hat viele Facetten: Wer kann den eigenen Eltern eigentlich erklären, was wir im Konzeptwerk machen? Wer fragt sich wie oft, ob die eigene Arbeit eigentlich gut genug ist? Wer liest nach Feierabend noch die eine oder andere politische Debatte zu Hause nach, um auch wirklich mitreden zu können? Wem fällt es wie einfach oder schwer, innerhalb unseres Lohnmodells über Geld zu reden? Usw.
Im Konzeptwerk haben wir uns, auch im Rahmen eines machtkritischen Prozesses, seit ca. 2016 aktiv mit verschiedenen Diskriminierungsformen im Konzeptwerk beschäftigt – auch mit Klassismus. Wir haben erfasst, wer überhaupt davon betroffen ist – und Empowermenträume für diese Gruppe geschaffen, haben uns intern dazu weitergebildet, Bücher, Podcasts etc. dazu geteilt.
Ein wichtiges Element dabei ist, wie wir versuchen, im Konzeptwerk über Geld zu reden. Wir wissen z. B. nicht nur die Löhne von allen, sondern auch deren Vermögen und ihren Klassenhintergrund. Wir reden darüber, wie unsere Herkunft und unsere aktuelle finanzielle Situation unser Verhältnis zu Geld prägt. Das ist auch herausfordernd, und wir lernen dabei viel zusammen – und es kann auch bestärkend sein, das oft als Tabu wahrgenommene Geld-Thema gemeinsam zu besprechen.
Darauf aufbauend versuchen wir, unser Lohnmodell möglichst solidarisch zu gestalten. D. h., der Lohn hängt bei uns nicht vor allem von Qualifikation oder „Leistung“ ab. Wir versuchen vielmehr zu berücksichtigen, was Menschen brauchen, um sich finanziell abgesichert zu fühlen. Dazu haben wir ein Modell, mit dem wir uns erst selbst einordnen und dann unsere Gehaltsvorstellungen in Kleingruppen besprechen und in der Gesamtgruppe beschließen.
Als drittes Element versuchen wir auch, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die explizit von Klassismus diskriminierte Gruppen vertreten, und wollen zukünftig auch noch mehr auf eine zugängliche Sprache in unserer Öffentlichkeits- und Projektarbeit achten. Wir sind weiter auf dem Weg. Und für uns steht es außer Frage, dass es zusätzlich immer auch politische Lösungen braucht – für eine Umverteilung von Vermögen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene.